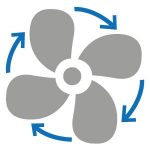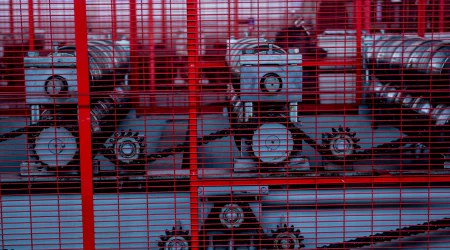Eine Kühlung sollte frühzeitig geplant werden, um Probleme während der heißen Monate im Sommer zu vermeiden. Dabei haben Arbeitgeber und private Haus- und Wohnungsbewohner mehrere Möglichkeiten zur Kühlung. Erfahren Sie bei Klimatechniker.net, welche Varianten zur Herabsetzung der Raumtemperatur möglich sind!
Die Planung einer ordentlichen Kühlung ist sowohl privat als auch beruflich für das persönliche Wohlbefinden wichtig: Besonders im Sommer führt eine fehlende Klimaanlage oder anderweitige Kühlung zu Unwohlsein und bei sehr hohen Temperaturen sogar zu gesundheitlichen Problemen. In der Klimatechnik werden daher verschiedene Methoden und Modelle unterschieden, die für die Kühlung der Gebäude und Räume geeignet sind.
Wo werden Kühlungen eingesetzt?
Kühlungen werden in der Regel überall dort geplant und eingesetzt, wo die Umgebungstemperatur für den Menschen unbehaglich ist. Dies ist vorrangig zum einen in Wohnräumen vor allem in den warmen Sommermonaten der Fall, zum anderen auch am Arbeitsplatz: Besonders die Arbeit in großen Hallen oder an heiß gelaufenen Fahrzeugen kann bei mangelhafter Kühlung und Lüftung zu gesundheitlichen Problemen und sinkender Leistungsfähigkeit führen. Aus diesem Grund geben die Technischen Regeln für Arbeitsstätten, die ASR, die genauen Regelungen und Anforderungen für die Raumluftqualität am Arbeitsplatz vor. Hier ist eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur vorgegeben, die laut der ASR A3.5 von 2010 nicht über 26 Grad Celsius steigen sollte. Bei höheren Temperaturen müssen die Fensterflächen mit entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet werden.
Dabei ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, für zumutbare Bedingungen zu sorgen – bereits beim Bau des Gebäudes muss die Kühlung so geplant werden, dass diese Bedingungen erfüllt sind.
Varianten und Modelle von Kühlungen
Die Kühlung an Arbeitsstätten und in Wohngebäuden kann sowohl aktiv als auch passiv erfolgen. Während am Arbeitsplatz vor allem aktive Kühlungsmethoden zum Einsatz kommen, kann die Temperatur in Wohnräumen schon mit wenig Aufwand auch passiv heruntergesetzt werden.
Aktive Kühlung mit mechanischen Hilfsmitteln
Große Unternehmen mit Lagerhallen, in denen gearbeitet wird, setzen vor allem auf aktive Kühlanlagen, da hier große Flächen belüftet und gekühlt werden müssen. Serverräume müssen oft schon in kleineren Dimensionen mit einer ausreichenden Kühlung geplant werden, da moderne Rechner zwar immer kleiner gebaut sind, aber dafür viel Wärme abgeben.
Aktive Kühlungen werden meistens in Form von mechanischen Geräten geplant. Dazu gehören in erster Linie Klimaanlagen, die die Raumluft im Winter auch aufheizen können. Dazu gehören zum Beispiel auch die Split-Klimageräte, bei denen der kühlende Bestandteil in die Wohnräume beziehungsweise die Arbeitsstätte montiert ist. Die Wärme wird über eine Fläche im Außenbereich – zum Beispiel durch einen Dachventilator – abgeleitet. Auch Wärmepumpen eignen sich mittlerweile dazu, auch als Kühlung eingesetzt zu werden. Diese wärmen die Raumluft normalerweise auf, moderne Modelle können diesen Kreislauf allerdings auch umkehren: Warme Luft wird aus der Umgebung, der Erde oder über Wasser aufgenommen und abgekühlt wieder abgegeben. Diese Geräte können dabei so geplant werden, dass sie im Sommer kühlen und im Winter für Wärme sorgen. Wird eine solche Kühlung mit solaren Kühlmethoden geplant, sparen Sie nicht nur Strom für Klimaanlagen, sondern schützen auch die Umwelt. Die Kältemaschine wird dabei nicht über an den Strom angeschlossen, sondern über das Sonnenlicht und die daraus gewonnene Energie betrieben.
Im eigenen Haus oder in der Wohnung nutzen die meisten Bewohner in den heißen Sommermonaten darüber hinaus Ventilatoren. Bei diesen ist allerdings zu beachten, dass es viele Geräte gibt, die nur mangelhaft arbeiten – lassen Sie sich für mechanische Kühlsysteme im privaten Haushalt am besten von einem Klimatechniker beraten, der auch passive Möglichkeiten mit Ihnen besprechen kann, die deutlich umweltfreundlicher sind.
Passive Kühlung ohne mechanische Hilfe
Bei der Planung der passiven Kühlung in einem Gebäude steht vor allem der bauliche Hitzeschutz im Vordergrund. Dieser trägt einen beträchtlichen Teil dazu bei, dass die bewohnten Räume im Sommer gekühlt werden und im Winter ausreichend warm sind. Dazu gehört zum Beispiel eine sorgfältige Wärmedämmung, denn vor allem über nicht gedämmte Wände und Böden gelangt die Hitze in das Gebäudeinnere. Vor allem die Südfassade wird so geschützt. Zu den baulichen Maßnahmen zur Kühlung der Wohnräume gehört aber auch die Planung des Wintergartens, der auch im Sommer genutzt werden soll und häufig an einer ungünstigen Stelle an das Haus angebaut wurde: Ist er nach Süden ausgerichtet, hat er eine besonders hohe Sonneneinstrahlung und wird dementsprechend vor allem im Sommer aufgeheizt. Eine Anbringung Richtung Norden bewirkt eine deutliche Herabsetzung der Innentemperatur.
Bauliche Maßnahmen zur Kühlung der Innentemperatur müssen jedoch meistens schon beim Neubau eingeplant werden – eine Nachrüstung ist oft teuer und für Mieter nur selten um- und durchsetzbar. Daher müssen diese häufig zu anderen Schutzmaßnahmen greifen, um sich vor übermäßiger Sonneneinstrahlung zu schützen. Arbeitgeber greifen dabei zu Maßnahmen für den Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, also zu Jalousien, Rollos oder Markisen. Diese Kühlungsmethoden können Sie auch in Ihrem Zuhause planen! Etwas teurer ist die Optimierung der Fensterflächen selbst, um den Sonnenlichteinfall zu verringern. Thermochrome Fenstergläser werden von manchen Arbeitgebern eingesetzt, da diese sich bei Erwärmung dunkler färben und so weniger lichtdurchlässig sind – dabei schützen sie den Mitarbeiter zusätzlich vor eventuell blendendem Sonnenlicht. Auch Dachflächenfenster heizen den Raum deutlich auf – wird das Dachgeschoss genutzt, sollte es ausreichend gekühlt werden. Lassen Sie die nötige und maximal mögliche Fensterverglasung am besten von einem Fachmann berechnen, denn übermäßig große Modelle führen zu vermehrt nötigen Maßnahmen zur Kühlung.
Auch Wärmepumpen können passiv arbeiten. Diese Methode ist zwar weniger leistungsstark als eine Klimaanlage, erweist sich im Betrieb jedoch als besonders energiesparend. Die Wärme wird bei diesen Modellen dem Raum entzogen und dem Boden zugeführt. Die Wärmepumpe sollte sowohl aktiv als auch passiv von einem Klimatechniker eingebaut und in Betrieb genommen werden.