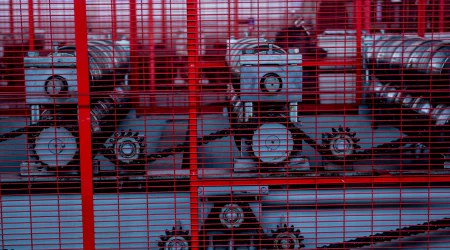Klimaanlagen sorgen in Wohnhäusern, Büros, Hotels und öffentlichen Einrichtungen für ein angenehmes Raumklima. Doch dieser Komfort hat auch seine Schattenseiten. Bei mangelnder Klimaanlagenwartung oder unsachgemäßer Nutzung können sich Bakterien in der Anlage ausbreiten. Die sogenannten Legionellen sind potenziell gesundheitsgefährdend und können über die Atemluft aufgenommen werden. Damit Sie diese Gefahr bannen können, sollten Sie wissen, wie Legionellen in Klimaanlagen entstehen, welche Erkrankungen sie auslösen können und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen sind.
- Was sind Legionellen?
- Welche Krankheiten können sie auslösen?
- Wie gelangen Legionellen in Klimaanlagen?
- Welche Klimaanlagen sind besonders gefährdet hinsichtlich Legionellen?
- Wie erkenne ich eine technische Kontamination?
- Überprüfung auf Legionellen in Klimaanlagen und Kühltürmen [Schritt-für-Schritt-Anleitung]
- Legionellen in Klimaanlagen: Was tun bei einem positiven Befund?
- Wie beugt man Legionellen in Klimaanlagen vor?
- Welche technischen Lösungen tragen zur Prävention von Legionellen in Klimaanlagen bei?
- Welche Rolle spielt die richtige Planung und Dimensionierung in Bezug auf Legionellen?
- Legionellen in Klimaanlagen: Das sind die gesetzlichen Vorschriften und Betreiberpflichten
- Legionellen nicht gemeldet? Hier droht ein saftiges Bußgeld!
- Welche regelmäßigen Wartungsmaßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben?
- Was kostet eine Legionellenprüfung oder -sanierung?
- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten
- Fazit
- Legionellen in der Klimaanlage: Häufig gestellte Fragen
- Quellen
Alles auf einen Blick:
- Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren. Das Bakterium kann über Aerosole eingeatmet werden und stellt vor allem für immunschwache Menschen eine Gesundheitsgefahr dar.
- Klimageräte mit feuchten Komponenten oder Wasserspeichern bieten ideale Wachstumsbedingungen für die Mikroorganismen, die vor allem Warmwasser um die 36 °C mögen.
- Besonders gefährdet sind zentrale Anlagen in Hotels, Kliniken oder Pflegeheimen. Sie können wahre Keimschleudern sein. Aber auch mobile Klimageräte sind nicht ausgeschlossen, genau wie Whirlpools, Luftbefeuchter oder eine länger nicht genutzte Dusche.
- Infektionen verlaufen mit grippeähnlichen Symptomen bis hin zu schwerer Lungenentzündung.
- Regelmäßige Reinigung, professionelle Wartung und technische Schutzmaßnahmen wie UV-Desinfektion senken das Infektionsrisiko erheblich.
Was sind Legionellen?
Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die natürlicherweise in Süßwasser vorkommen. In geringer Konzentration sind sie für den Menschen unproblematisch, werden aber schnell zu einem Krankheitserreger. Kritisch wird es, wenn sie sich in technischen Anlagen wie Klimaanlagen, Trinkwassersystemen oder Kühltürmen stark vermehren. Gefährlich ist dabei nicht das bloße Vorhandensein der Bakterien, sondern das Einatmen kontaminierter Aerosole. Aerosole entstehen beispielsweise beim Duschen, durch Wasserzerstäuber oder bei bestimmten klimatischen Betriebsbedingungen. Die gefährlichste Legionellen-Art für den Menschen ist Legionella pneumophila. Wird sie über die Atemwege aufgenommen, kann sie zu schweren Erkrankungen führen. Vor allem für ältere Menschen, Raucher, immungeschwächte Personen und Personen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder chronischen Lungenerkrankungen wie COPD stellt sie eine Gefahr dar.
Woher kommt der Name Legionellen?
Die Namensgebung für Legionellen ist auf einen Ausbruch der Legionärskrankheit bei einem Treffen der American Legion, einer Veteranenorganisation der Streitkräfte der Vereinigten Staten, im Jahr 1976 zurückzuführen. Dieser Ausbruch, bei dem eine „mysteriöse Krankheit“ auftrat, führte zur Identifizierung des Erregers und zum ungewöhnlichen Namen.
Warum sind Legionellen so gefährlich?
Weil sie mikroskopisch klein sind, gelangen Legionellen tief in die Lunge und können dort Entzündungen auslösen. Die Infektion erfolgt nicht durch Hautkontakt, sondern fast ausschließlich durch das Einatmen kontaminierter Wassertröpfchen. Besonders gefährlich ist die Resistenz der Bakterien gegenüber vielen Standarddesinfektionsmitteln sowie ihre Fähigkeit, sich in schlecht gewarteten Anlagen explosionsartig zu vermehren. Legionellen überleben in sogenannten Biofilmen, also in schleimigen Belägen innerhalb von Rohrleitungen oder Wasserbecken. Dort sind sie nur schwer zu beseitigen.
Welche Krankheiten können sie auslösen?
Legionellen können zwei Hauptformen von Erkrankungen verursachen: die Legionärskrankheit (auch Legionellose [1] genannt) und das Pontiac-Fieber.
- Die Legionärskrankheit ist eine schwere Form der Lungenentzündung (Pneumonie) mit einer hohen Sterblichkeitsrate, wenn sie nicht frühzeitig behandelt wird. Sie tritt vor allem bei älteren Menschen, Rauchern oder Patienten mit geschwächtem Immunsystem auf.
- Das Pontiac-Fieber ist dagegen eine mildere Erkrankung ohne Lungenbeteiligung. Sie verläuft ähnlich wie eine Grippe und heilt in der Regel nach wenigen Tagen von selbst aus.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die jeweiligen Krankheiten von Legionellen ausgelöst wurden. Denn nur so kann die Kontamination beseitigt und der Rest der Hausbewohner geschützt werden.
Wie viele Menschen erkranken an Legionellen?
Deutschland verzeichnete im Jahr 2018 eine Meldeinzidenz von 1,7 Legionellose-Fällen pro 100.000 Einwohner und liegt damit knapp unter dem europäischen Durchschnitt von 1,8 Fällen pro 100.000. Da jedoch längst nicht alle Lungenentzündungen auf eine mögliche Legionelleninfektion hin untersucht werden, ist von einer deutlichen Dunkelziffer auszugehen. Schätzungen aus Studien zufolge könnte die tatsächliche Inzidenz nicht-krankenhausassoziierter Legionärskrankheiten deutlich höher liegen: zwischen 18 und 36 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner.
Gemäß § 7 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) muss der direkte oder indirekte Nachweis von Legionellen, sofern er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Diese Meldung muss innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden erfolgen. Wer zur Meldung verpflichtet ist, wird in § 8 IfSG festgelegt. Dazu zählen unter anderem behandelnde Ärzte sowie Labore.
Welche Symptome deuten auf eine Legionelleninfektion hin?
Die Symptome sind oft unspezifisch und werden daher leicht mit einer Erkältung oder Grippe verwechselt. Diese ersten Anzeichen treten in der Regel innerhalb von zwei bis zehn Tagen nach der Infektion auf. Dazu gehören:
- plötzliches Fieber
- trockener Husten
- Kopfschmerzen
- Gliederschmerzen
- allgemeine Erschöpfung
- Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen
Welche gesundheitlichen Beschwerden können auftreten?
- schwere Lungenentzündung (Legionärskrankheit)
- Atemnot
- Verwirrtheit oder neurologische Symptome
- bei der milderen Form (Pontiac-Fieber): grippeähnliche Beschwerden ohne Lungenbeteiligung
Achten Sie darauf, ob mehrere Personen in Ihrem Umfeld wiederholt oder ungewöhnlich an Atemwegserkrankungen leiden. Dies kann auf technische Ursachen wie verunreinigte Klimaanlagen oder Luftbefeuchter hinweisen.
Wie gelangen Legionellen in Klimaanlagen?
Legionellen gelangen in Klimaanlagen, wenn sie sich in wasserführenden Teilen wie Dampfbefeuchtern, Verdunstungskühlern oder Kondenswasserbehältern ansiedeln und dort unter günstigen Bedingungen vermehren.
Klimaanlagen nutzen je nach System unterschiedliche Methoden zur Wasserversorgung. Geräte mit Luftbefeuchter oder Verdunstungskühler beziehen ihr Wasser meist direkt aus dem Trinkwassernetz. Bei herkömmlicher Klimatechnik entsteht Wasser hingegen als sogenanntes Kondenswasser, also durch das Entfeuchten der Luft. Wo Wasser ist, können sich auch Legionellen befinden, die aber in geringer Anzahl noch ungefährlich sind. Problematisch wird es, wenn günstige Bedingungen für ihre Vermehrung vorliegen. Dann kann sich eine anfangs geringe Konzentration rasch zu einem ernsthaften Gesundheitsrisiko entwickeln. Besonders kritisch ist der Temperaturbereich zwischen 25 und 45 Grad Celsius, also genau die Temperaturen, die oft im Inneren von Klimaanlagen herrschen. Unter solchen Bedingungen können sich Legionellen innerhalb weniger Tage stark vermehren.
Welche Klimaanlagen sind besonders gefährdet hinsichtlich Legionellen?
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen), wie sie häufig in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden eingesetzt werden, stellen ein besonders hohes Risiko für die Verbreitung von Legionellen dar.
Aufgrund ihrer
- zahlreichen wasserführenden Komponenten,
- langen Leitungsstrecken und
- komplexen Luftbefeuchtungssysteme
bieten sie ideale Bedingungen für das Wachstum und die Verbreitung der Bakterien. Besonders kritisch ist dabei die Entstehung von Aerosolen, durch die Legionellen in die Raumluft gelangen und von Menschen eingeatmet werden können. Daher sind diese Anlagen regelmäßig zu warten und zu überwachen, um die Gefahr von Legionelleninfektionen wirksam zu minimieren.
Aber auch wenn Sie eine mobile Klimaanlage nutzen oder wenn Sie in einem privaten Haushalten eine Splitklimaanlage montieren agieren Sie keineswegs grundsätzlich risikofrei, sofern Wassertanks für Kondensat, Luftbefeuchtungssysteme oder feuchte Filter enthalten sind. Werden solche Geräte nicht regelmäßig entleert, gereinigt oder gewartet, können sie zur Keimschleuder werden, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubbelastung. Besonders gefährlich sind selten genutzte Anlagen, wie etwa saisonal betriebene Klimaanlagen oder Notfallanlagen in Technikräumen, da sich hier Keime ungestört vermehren können.
Welche Teile einer Klimaanlage sind besonders anfällig?
| Bauteil | Grund für Anfälligkeit |
|---|---|
| Kondensatwannen |
|
| Luftbefeuchter |
|
| Verdunstungskühler |
|
| Filter |
|
| Rohrleitungen |
|
| selten genutzte Komponenten |
|
Installieren Sie in größeren Anlagen am besten Kondensatpumpen mit Alarmsystem, die bei stehendem Wasser automatisch Meldung geben. So lässt sich eine Keimbildung frühzeitig erkennen und beheben.
Wie erkenne ich eine technische Kontamination?
- grünlich-schleimige Beläge
- übermäßige Feuchtigkeit
- muffiger Geruch aus Luftauslässen
- ungewöhnlich viel Kondenswasser oder Wasserpfützen
Diese Merkmale sind wichtige Warnsignale für mögliche hygienische Probleme und sollten Anlass geben, eine Reinigung oder Überprüfung durchzuführen. Ein Nachweis von Legionellen ist jedoch nur durch eine gezielte mikrobiologische Untersuchung möglich. Die genannten Anzeichen können also auf ein erhöhtes Risiko für Legionellen hinweisen, sind aber kein sicheres Erkennungsmerkmal.
Welche Maßnahmen sind bei einem Legionellenverdacht zu ergreifen?
Bei einem Legionellenverdacht sollten Sie die betreffende Klimaanlage umgehend vom Betrieb nehmen. Ob es sich wirklich um einen Legionellenbefall handelt, kann nur die Laborauswertung beantworten. Dazu wird eine Wasserprobe aus der Anlage genommen und mikrobiologisch analysiert. Die Anlage sollten Sie bis zum Vorliegen der Ergebnisse nicht wieder einschalten, da durch die Luftverteilung potenziell gefährliche Keime verbreitet werden.
Überprüfung auf Legionellen in Klimaanlagen und Kühltürmen [Schritt-für-Schritt-Anleitung]
1. Vorbereitung der Probenahme
- Vor dem Probentermin werden eine gezielte Spülung sowie eine Temperaturkontrolle durchgeführt, um Stagnationsphasen zu minimieren und aktuelle Betriebsbedingungen abzubilden. So vermeidet man, dass eine Probe versehentlich einen „Ausreißer-Befund“ liefert, der nur auf eine vorübergehende Stagnation und nicht auf einen dauerhaften hygienischen Mangel zurückzuführen ist.
- Zusätzlich muss überprüft werden, ob alle Probenahmestellen gut zugänglich sind.
2. Systemanalyse & Festlegung des Probenplans
- Zuerst werden alle wasserführenden Bereiche, die Aerosole erzeugen können (zum Beispiel Kühlturmsumpf, Sprühdüsen, Luftbefeuchterkammern, Kondensatwannen), überprüft.
- Im Anschluss wird vom Fachmann ein sogenannter Probenplan erstellt. Es handelt sich dabei um einen strukturierten Ablaufplan, der festlegt, wann, wo, und wie Wasserproben entnommen und auf Legionellen untersucht werden sollen. Ziel ist es, potenzielle Gesundheitsgefahren durch Legionellen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
3. Desinfektion der Entnahmepunkte
- Bei Wasserproben aus technischen Anlagen (Kühltürme, Verdunstungskühlanlagen) ist die Desinfektion der Entnahmestellen mit Alkohol oder Abflammen sinnvoll und wird empfohlen. Bei anderen Klimaanlagenkomponenten (zum Beispiel Split-Klimaanlagen) ist sie nur dann notwendig, wenn gezielt Wasserproben entnommen werden und die Gefahr der Kontamination durch Fremdkeime besteht.
4. Probenahme (Wasserprobe)
- Proben werden an einer festgelegten, repräsentativen Stelle entnommen. Dazu werden ausschließlich sterile Gefäße verwendet, um eine Verfälschung der Probe zu vermeiden.
- Die vorgeschriebene Wassermenge (etwa mindestens 250 ml Verdunstungs-/Kühlwasser, nachdem das Wasser mindestens 30 Sekunden abgelaufen ist) wird entnommen.
- Make-up- und Kondensatwasser sollten gegebenenfalls separat beprobt werden.
- Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit werden direkt vor Ort gemessen und dokumentiert.
5. Oberflächen- bzw. Kontaktprobe (optional, bei RLT-Anlagen)
- An sensiblen Stellen wie Luftbefeuchterkammern, Tropfenabscheidern oder Filterwannen werden mit einer 25 cm²-Kontaktplatte (RODAC) oder Abstrichtupfern Kontaktproben entnommen.
6. Transport der Proben
- Die Proben werden sofort auf circa 4 °C gekühlt und innerhalb von 24 Stunden an ein akkreditiertes Labor versandt.
7. Laboranalyse
- Im Labor werden die koloniebildenden Einheiten (KBE) von Legionellen analysiert.
- Moderne Labore nutzen Kultivierungsverfahren oder molekularbiologische Methoden wie PCR, um auch schwer nachweisbare Biofilmbildner zu erkennen.
8. Bewertung & Maßnahmen
Die Laborergebnisse werden nach vorgegebenen Grenzwerten beurteilt. Die Ergebnisse zeigen, ob Grenzwerte überschritten sind, und bilden die Grundlage für die notwendigen Maßnahmen:
- < 100 KBE/100 ml: Betriebsfortführung
- 100 bis < 1.000 KBE/100 ml: Ursachenanalyse, Optimierung der Wasseraufbereitung
- ≥ 1.000 KBE/100 ml: unverzügliche Gefahrenabwehr (Schockdesinfektion, gebenenfalls Abschalten), Meldung an die Behörde
9. Dokumentation
- Alle Schritte, Messwerte, Probenorte, Daten sowie die Namen des Probenehmers und die Laborergebnisse werden lückenlos in einem Hygiene-Logbuch festgehalten.
10. Regelmäßige Wiederholung
- Verdunstungs-/Kühltürme: mindestens alle drei Monate (gemäß 42. BImSchV)
- RLT-Anlagen mit Befeuchtung: Hygieneinspektion alle zwei Jahre, ohne Befeuchtung alle drei Jahre (nach VDI 6022)
Mit diesem strukturierten Vorgehen durche einen Fachbetrieb erfüllen Betreiber die gesetzlichen Pflichten und reduzieren das Risiko einer Legionellenbelastung deutlich.
Legionellen in Klimaanlagen: Was tun bei einem positiven Befund?
- Beauftragung eines spezialisierten Fachbetriebs
- Desinfektion aller betroffenen Anlagenteile
- gründliche Reinigung von Filtern, Befeuchtern und Kondensatwannen
- gegebenenfalls Austausch kontaminierter Bauteile
Bei gewerblich oder öffentlich genutzten Gebäuden:
- zuständige Gesundheitsbehörde informieren
- Nutzer müssen ebenfalls schriftlich, per Aushang oder per E-Mail über die Situation und die empfohlenen Verhaltensmaßnahmen informiert werden
Wie beugt man Legionellen in Klimaanlagen vor?
Legionellen in Klimaanlagen beugt man vor, indem man regelmäßig Wasser führende Komponenten reinigt, desinfiziert und überprüft, Stagnation vermeidet, die Wassertemperaturen kontrolliert und die Anlage gemäß den geltenden Hygienevorschriften betreibt. Bereits bei der Auswahl und Auslegung einer Anlage sollten Sie auf wartungsfreundliche Bauteile und leicht zugängliche Wasserführungen achten. Im laufenden Betrieb gilt: Kondensatwannen müssen regelmäßig entleert, Filtereinheiten getauscht und Befeuchter gründlich gereinigt werden. Besonders in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Küchen sowie in sensiblen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeheimen oder Krankenhäusern ist höchste Wachsamkeit geboten. Wasser sollte in keinem Teil der Anlage über längere Zeit stehen bleiben. Eine sorgfältige Dokumentation von Wartungs- und Reinigungsintervallen hilft dabei, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.
Welche technischen Lösungen tragen zur Prävention von Legionellen in Klimaanlagen bei?
Besonders bewährt haben sich UV-Desinfektionseinheiten, automatische Spülsysteme, antibakterielle Beschichtungen und hochwertige Filtersysteme. Dabei gilt es zu beachten, dass all diese Techniken unterstützend aktiv sind und keinen Ersatz für regelmäßige Hygienemaßnahmen darstellen. Ohne regelmäßige Pflege werden sie ebenfalls schnell wirkungslos.
Was ist eine UV-Desinfektionseinheit und wozu wird sie in Klimaanlagen eingesetzt?
Eine UV-Desinfektionseinheit ist ein Gerät, das keimtötendes UV-C-Licht nutzt, um Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Schimmelpilze zuverlässig abzutöten oder inaktiv zu machen. In Klimaanlagen kommt sie vor allem dort zum Einsatz, wo sich durch Feuchtigkeit Keime leicht vermehren können, etwa in Luftbefeuchtern, Tropfenabscheidern oder Kondensatwannen. Durch die Bestrahlung mit UV-Licht wird das Erbgut der Mikroorganismen zerstört, sodass sie sich nicht mehr vermehren können. Die Methode ist chemiefrei, rückstandslos und sofort wirksam, setzt aber voraus, dass das UV-Licht alle zu behandelnden Flächen oder Flüssigkeiten ungehindert erreicht. UV-Desinfektionseinheiten tragen so wesentlich zur Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen bei und helfen, das Risiko einer Legionellenvermehrung wirksam zu reduzieren. Die Desinfektion läuft in der Regel automatisch ab, entweder im Dauerbetrieb oder in definierten Intervallen, um eine gleichbleibend hohe keimtötende Wirkung sicherzustellen.
Was sind automatische Spülprogramme zur Beseitigung von Legionellen in Klimaanlagen?
Automatische Spülprogramme in Klimaanlagen dienen der Vorbeugung von Legionellen, indem sie stagnierendes Wasser in wasserführenden Anlagenteilen wie Luftbefeuchtern, Verdunstungskühlern oder Kondensatwannen in regelmäßigen Intervallen automatisch durch Frischwasser ersetzen. Sie werden zeit- oder sensorgesteuert aktiviert, verhindern die Bildung von Biofilmen und reduzieren damit das Risiko einer Legionellenvermehrung deutlich. Besonders in Anlagen mit längeren Standzeiten oder unregelmäßigem Betrieb sorgen automatische Spülprogramme für eine hygienisch einwandfreie Betriebsweise und sind ein empfohlener Bestandteil der technischen Maßnahmen nach VDI 6022. [2]
Gibt es spezielle Filtersysteme oder antibakterielle Beschichtungen zur Bekämpfung von Legionellen in Klimaanlagen?
Viele Hersteller bieten mittlerweile Filtersysteme mit antimikrobieller Ausstattung sowie spezielle Beschichtungen für feuchte Systemteile an:
- HEPA-Filter mit Silberionenbeschichtung oder Kupferanteilen hemmen das Wachstum von Bakterien und Pilzen. HEPA-Filter selbst sind jedoch vor allem für die Partikelfiltration ausgelegt. Ihre antimikrobielle Ausstattung ist ein zusätzlicher Schutz, der Biofilmbildung auf dem Filter reduzieren kann.
- Beschichtete Kondensatwannen oder Verdunsterelemente verhindern das Anhaften von Biofilmen.
Hygienefilter, die in viele Systemen auch nachträglich integriert werden können, machen insbesondere dort Sinn, wo eine hohe Personendichte oder besondere Empfindlichkeit besteht. Beispiele hierfür sind Wartezimmer, Behandlungsräume oder Großraumbüros. Dabei gilt: Die Filter sollten regelmäßig nach Herstellerangaben ersetzt werden. Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus, da Bakterien und Pilze auch in scheinbar sauberen Filtern aktiv sein können.

Welche Rolle spielt die richtige Planung und Dimensionierung in Bezug auf Legionellen?
Die richtige Planung und Dimensionierung einer Klimaanlage ist entscheidend für die hygienische Sicherheit im späteren Betrieb. Bereits in der Planungsphase wird festgelegt, wie effizient Luft und Wasser im System zirkulieren und damit auch, wie hoch das Risiko für stagnierendes Wasser und Keimwachstum ist. Besonders problematisch ist eine Überdimensionierung: Wird die Anlage zu groß ausgelegt, läuft sie häufig außerhalb des optimalen Betriebsbereichs. Die Folge sind
- längere Stillstandszeiten,
- unzureichende Durchströmung wasserführender Komponenten und
- einegeringe Auslastung der Luftbefeuchtungseinheiten.
Das sind ideale Bedingungen für die Vermehrung von Legionellen. Auch schlecht zugängliche oder falsch platzierte Bauteile erschweren spätere Klimaanlagenwartungen und Reinigungen. Eine fachgerechte, bedarfsgerechte Planung ist daher ein zentraler Baustein in der Legionellenprävention und trägt wesentlich zur Betriebssicherheit und Hygiene der Anlage bei.
Legionellen in Klimaanlagen: Das sind die gesetzlichen Vorschriften und Betreiberpflichten
- Registrierung und Anzeige der Anlage bei der zuständigen Behörde (bei Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen, Nassabscheidern)
- regelmäßige mikrobiologische Untersuchungen auf Legionellen (je nach Anlagentyp: mindestens alle 3 Monate bis alle 3 Jahre)
- Einhaltung der Prüf- und Maßnahmenwerte
- Dokumentation aller Maßnahmen und Ergebnisse
- sofortige Meldung bei Überschreitung der Maßnahmenwerte und Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen
Wer ist zur Legionellenprüfung verpflichtet?
Privathaushalte, die zum Beispiel eine mobile Klimaanlage oder Split-Klimaanlage nutzen, die kein offenes Wassersystem enthalten, sind von der Testpflicht ausgenommen. Gleiches gilt für eine lufttechnische Anlage mit Luftbefeuchtung oder Verdunstungskühlung im Haus. In diesem Fall wird jedoch eine mikrobiologische Prüfung empfohlen. Die VDI 6022 regelt die allgemeine Hygiene. Bei Verdunstungskühlanlagen und Kühltürmen sind die Anforderungen der 42. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) verbindlich. [3]
Gesetzlich verpflichtet sind aber gewerbliche oder öffentliche Betreiber. Hier greift die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), wenn es sich um größere Trinkwasseranlagen mit zentralem Warmwassersystem handelt. Das betrifft Mietshäuser, Hotels, Krankenhäuser oder Schulen. Betreiben Sie eine Verdunstungskühlanlage, einen Kühlturm oder Nassabscheider mit Wasserkontakt, greift auch hier die 42. BImSchV. Öffentliche oder gewerbliche Betreiber müssen turnusmäßig Proben entnehmen lassen, Auffälligkeiten melden und bei positivem Legionellenbefund sofort handeln.
Wer darf eine Legionellenprüfung durchführen?
Die Untersuchung auf Legionellen darf ausschließlich von zertifizierten Fachfirmen vorgenommen werden, die mit akkreditierten Laboren zusammenarbeiten. Dabei müssen sie die Vorgaben einschlägiger technischer Regelwerke wie der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der Verordnung zur Durchführung des 42. BImSchV beachten.
Rechtlich verbindlich sind ausschließlich Laborberichte von zugelassenen Untersuchungsstellen. Diese Berichte dienen als wesentliche Entscheidungsgrundlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen oder behördliche Anordnungen.
Legionellen nicht gemeldet? Hier droht ein saftiges Bußgeld!
Bei Verstößen gegen die Melde- und Anzeigepflicht von Legionellen können Bußgelder von bis zu 25.000 Euro fällig werden. Unwissenheit schützt im Schadensfall auch hier nicht vor Strafe. Ein Schadensfall im Zusammenhang mit Legionellen in Klimaanlagen meint in der Regel eine Legionelleninfektion bei Menschen, die nachweislich oder mutmaßlich durch eine kontaminierte Anlage verursacht wurde. Solche Fälle fallen insbesondere ins Gewicht, wenn Personen erkranken oder die erkrankten Personen sogar versterben, zum Beispiel durch die Legionärskrankheit und die damit zusammenhängende Pneumonie.
Bei Verstößen gegen die gesetzlich vorgeschriebene Melde- und Anzeigepflicht im Zusammenhang mit Legionellen können gemäß § 25 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit der 42. BImSchV Bußgelder von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Betreiber von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) oder Verdunstungskühlanlagen sind verpflichtet, regelmäßig mikrobiologische Untersuchungen durchzuführen und auffällige Befunde unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Die Meldepflicht gilt insbesondere bei Anlagen, in denen Wasser vernebelt oder verdunstet wird und so legionellenbelastete Aerosole freigesetzt werden können.
Ein Schadensfall liegt dann vor, wenn Menschen nachweislich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine kontaminierte Anlage mit Legionellen infiziert wurden. Dies betrifft häufig erkrankte Personen, bei denen eine Pneumonie (Lungenentzündung) im Rahmen einer Legionärskrankheit diagnostiziert wird. Besonders gravierend sind solche Vorfälle, wenn mehrere Personen erkranken oder es infolge der Infektion zu Todesfällen kommt. Kritisch sind in diesem Zusammenhang
- bauliche Hygienemängel,
- unzureichende Wartung oder
- fehlende Dokumentation.
Typische Beispiele für relevante Schadensfälle
- Ausbruch einer Legionellose in einem Hotel, Pflegeheim, Krankenhaus oder Bürogebäude infolge unzureichend gewarteter Klimaanlagen oder Luftbefeuchter
- Krankheit oder Tod einer Person, die sich im Einflussbereich einer nicht ordnungsgemäß betriebenen oder gewarteten Verdunstungskühlanlage aufgehalten hat
- fehlende Meldung einer Legionellenkontamination an die zuständige Behörde trotz Nachweis durch ein akkreditiertes Labor
- unzureichende Dokumentation der Wartung und Prüfung, wodurch sich der Betreiber im Schadensfall nicht entlasten kann
Welche regelmäßigen Wartungsmaßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben?
| Wartungsmaßnahme | empfohlenes Intervall | Hinweis |
| Reinigung der Kondensatwanne | mindestens einmal jährlich | häufigere Reinigung bei hoher Luftfeuchtigkeit oder gewerblicher Nutzung |
| Austausch oder Reinigung der Filter | mindestens einmal jährlich | halbjährlich oder vierteljährlich in sensiblen Bereichen |
| Wartung der Luftbefeuchter | mindestens einmal jährlich | halbjährlich bei Dauerbetrieb oder hoher Luftfeuchtigkeit |
| Sichtprüfung auf Ablagerungen | mindestens einmal jährlich | Empfehlung: Kombination mit der Filterwartung |
| mikrobielle Untersuchung (Legionellen) | alle zwölf Monate | Pflicht gemäß 42. BImSchV bei bestimmten Anlagentypen |
| Wartungsvertrag mit Fachfirma | individuell vereinbar | empfohlen zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen |
Führen Sie am besten ein Wartungstagebuch, in dem alle Maßnahmen dokumentiert werden. So können Sie im Ernstfall nachweisen, dass alle Betreiberpflichten erfüllt wurden.
Was kostet eine Legionellenprüfung oder -sanierung?
Für die regelmäßige Eigenkontrolle in Privathaushalten bieten sich Selbsttests aus dem Handel an, die rund 50 Euro kosten. Diese sind allerdings nur fürs Trinkwasser gedacht. Für Klimaanlagen, Kühltürme oder RLT-Anlagen sind solche Tests nicht geeignet, da die Probenahme, Auswertung und Dokumentation spezielles Fachwissen erfordern. Gewerbliche Anbieter sind dazu verpflichtet, die Kontrolle und Sanierung durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Die richtigen Ansprechpartner hierfür sind Fachfirmen für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik aber auch Installateur- und Heizungsbaufachbetriebe. Drei bis fünf Probenentnahmen mit Laboranalyse kosten in der Regel zwischen 200 und 1.000 Euro, abhängig von der Entfernung, dem Aufwand und der Laborleistung. Die Einrichtung von Probeentnahmestellen, also Installationen von speziellen Probenhahnehähnen, Armaturen oder Anschlüssen an geeigneten Stellen im Leitungssystem oder in Anlagenkomponenten, kann zusätzliche Kosten verursachen, ist aber meist nicht Teil der regulären Prüfung.
Muss die Anlage saniert werden, dann sind die Sanierungskostensehr unterschiedlich und hängen stark von der Anlagengröße, dem Umfang der Maßnahmen und dem Befall ab:
- kleinere Maßnahmen wie Spülung oder Desinfektion kosten meistwenige hundert Euro aufwärts.
- umfangreiche Sanierungen wie der Austausch von Komponenten, Demontage oder chemische Reinigung können bei großen Anlagen durchaus 10.000 Euro oder mehr kosten.
Welche Kosten entstehen für Desinfektion, Spülung oder Bauteiltausch?
Die thermische Desinfektion ist meist Teil einer umfassenden Wartung, zu der auch die Reinigung, Funktionsprüfung und der Filtertausch gehören, sofern diese nötig sind. Hier sollten Sie mit durchschnittlichen Kosten von 100 bis 400 Euro pro Einheit rechnen, wobei einzelne Maßnahmen günstiger sein können. Handelt es sich um eine komplexere Anlage, wie zum Beispiel ein Multisplit-System mit mehreren Inneneinheiten, können die Preise höher ausfallen. Spülungen können ab 30 Euro pro Rohrmeter durchgeführt werden. Müssen einzelne Bauteile ausgetauscht werden, dann können die Kosten bis zu mehrere Tausend Euro betragen. Die günstigsten Bauteile sind Filtereinsätze und Filtermatten, die es bereits ab 10 Euro pro Stück gibt. Richtig teuer wird es hingegen, wenn beispielsweise die Luftbefeuchter-Kammer einer RLT-Anlagen ausgetauscht werden muss, da die Kosten dafür zwischen 400 und 1.200 Euro liegen. Hinzu können weitere Kostenpunkte wie Montage, Arbeitszeit sowie An- und Abfahrt des Fachbetriebs kommen.
Was kostet eine turnusmäßige Wartung im Vergleich zur Nachsanierung?
Klimaanlage-Wartungskosten liegen preislich zwischen 100 und 400 Euro, immer in Abhängigkeit von der Art und Größe der Anlage sowie dem Umfang der durchzuführen Arbeiten, wobei Sie mit einem Wartungsvertrag in der Regel eher im unteren Bereich liegen.
Kleinteile wie zum Beispiel ein Filter können bereits im Zuge einer Wartung ausgetauscht werden. Nachsanierungen sind in der Regel als komplizierter einzustufen und werden häufig teurer, weil zusätzlich zur Prüfung der Anlage noch Material- und Arbeitskosten hinzukommen. Je nach dem Alter, Zustand und Anzahl der betroffenen Teile gilt es genau abzuwägen, welcher Weg wirtschaftlicher ist. Eine gezielte Bauteilerneuerung ist in der Regel günstiger als eine Komplettsanierung, aber nur dann sinnvoll, wenn die Ursache von einem Fachbetrieb genau lokalisiert wurde. In alten Anlagen empfiehlt sich dagegen oft ein Komplettaustausch, um langfristig Betriebssicherheit und Hygiene zu gewährleisten. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, dass eine gewissenhafte Wartung das Risiko von Verunreinigungen minimiert und damit auch teure Folgekosten, die im Rahmen einer Nachsanierung entstehen. Aus diesem Grund sollten Sie nicht am falschen Ende sparen. Wenden Sie sich an einen Fachmann, der Ihnen eine professionelle Einschätzung gibt.
Diese 5 Dinge sollten Sie beachten
- Lassen Sie sich in die Bedienung einführen und schulen Sie auch weitere Nutzer und Mitarbeiter. Die beste Anlage ist nur so sicher wie ihr Bedienverhalten. Klare Anleitungen, Hinweise und Dokumentation helfen dabei.
- Achten Sie auf Komponenten mit glatten, antibakteriellen Oberflächen, auf gute Erreichbarkeit aller wartungsrelevanten Bauteile und auf die Möglichkeit zur automatischen Hygienespülung. Besonders bei Luftbefeuchtern und Verdunstungselementen ist ein werkzeugloser Zugang zur Reinigung von Vorteil.
- In strömungsarmen Bereichen der Lüftungsführung können sich Feuchtigkeit und Staub ablagern, was einen idealen Nährboden für Keime schafft. Achten Sie deshalb bereits bei der Planung oder wenn Sie eine Klimaanlage nachrüsten auf strömungsgünstige Leitungsverläufe.
- Klimaanlagen, die nur im Sommer betrieben werden, sollten bei Wiederinbetriebnahme zwingend gespült und kontrolliert werden. Gerade längere Standzeiten fördern die mikrobielle Belastung.
- Kalkablagerungen in Luftbefeuchtern, Leitungen oder Verdunstungselementen bieten eine ideale Oberfläche für die Bildung von Biofilmen und erschweren die Reinigung erheblich. Durch den Einsatz von entkalktem oder enthärtetem Wasser lassen sich diese Ablagerungen deutlich reduzieren – ein einfacher, aber wirkungsvoller Hygieneschutz.
Fazit
Klimaanlagen sind heute fester Bestandteil moderner Gebäude – sei es im Wohnbereich, in Büros, öffentlichen Einrichtungen oder Industrieanlagen. Doch ihr hygienischer Betrieb erfordert mehr als nur Technik: Er verlangt Aufmerksamkeit, Fachwissen und Verantwortung. Insbesondere das Risiko durch Legionellen sollte nicht unterschätzt werden. Sie sind kein seltenes Problem, sondern ein reales Gesundheitsrisiko, das sich bei fehlender Wartung oder fehlerhafter Planung unbemerkt entwickeln kann. Umso wichtiger ist es, von Anfang an auf eine durchdachte Anlagenplanung, fachgerechte Installation und regelmäßige, dokumentierte Wartung zu setzen. Mit automatisierten Spülungen, gezielter Reinigung und einer lückenlosen Kontrolle lässt sich eine Keimbelastung effektiv verhindern. Ob in Privathaushalten oder großen Gebäudekomplexen: Wer seine Anlage versteht, pflegt und verantwortungsvoll betreibt, sorgt nicht nur für ein angenehmes Raumklima, sondern schützt zugleich die Gesundheit aller Nutzer, dauerhaft und nachhaltig.
Legionellen in der Klimaanlage: Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine mobile Klimaanlage bedenkenlos im Schlafzimmer nutzen?
Solange das Gerät keine wasserführenden Elemente enthält, können Sie es bedenkenlos im Schlafzimmer nutzen. Bei Geräten mit Wassertank oder Befeuchterfunktion ist tägliches Entleeren und Reinigen Pflicht. Andernfalls kann selbst ein kleines Gerät zur Keimquelle werden.
Was ist der Unterschied zwischen Desinfektion und Reinigung einer Klimaanlage?
Reinigung entfernt Schmutz und Staub. Desinfektion tötet Mikroorganismen ab. Beide Schritte sind notwendig: Erst reinigen, dann desinfizieren. Nur in Kombination wird eine hygienisch sichere Anlage erreicht.
Wie schnell können sich Legionellen nach dem Ausschalten einer Klimaanlage vermehren?
Unter optimalen Bedingungen vermehren sich Legionellen besonders schnell: Bei einer Temperatur von etwa 36 °C und ausreichend verfügbaren Nährstoffen kann sich ihre Anzahl bereits innerhalb von nur rund drei Stunden verdoppeln. Selbst bei einem geringeren Nährstoffangebot erfolgt die Vermehrung noch relativ rasch. Die Verdopplungszeit liegt dann zwischen etwa 22 und 72 Stunden. Diese hohe Anpassungsfähigkeit macht Legionellen besonders gefährlich in wasserführenden Systemen mit unzureichender Hygiene oder stagnierendem Wasser.
Kann ich meine Klimaanlage auch komplett umrüsten lassen, um das Risiko zu minimieren?
Insbesondere bei älteren oder stark kontaminierten Systemen ist ein Komplettaustausch oft wirtschaftlicher und hygienisch sicherer als eine aufwendige Einzelsanierung. Dabei können moderne Komponenten mit antibakteriellen Oberflächen, UV-Systemen und Spülprogrammen integriert werden, um zukünftige Risiken deutlich zu verringern.
Quellen
[1] „Legionellose“. Rki.de, 10. Dezember 1999, https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Legionellose.html.
[2] Vdi.de, https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-6022. Zugegriffen 2. Juli 2025.
[3] https:/www.gesetze-im-internet.de/bimschv_42/. Zugegriffen 2. Juli 2025.
[4] Gesetze-im-internet.de, https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__535.html. Zugegriffen 2. Juli 2025.