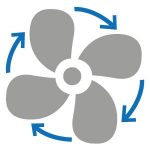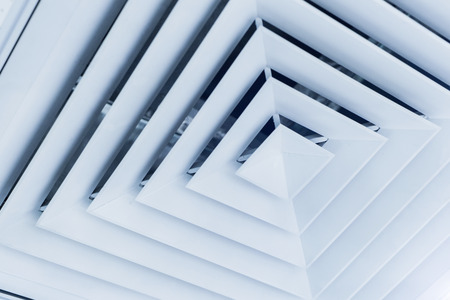Nach Abschluss des Baus sind Unmengen an überschüssigem Wasser in den Bausubstanzen eingelagert. Eine fachgerechte Bautrocknung ist hier nicht nur auf Grund der verkürzten Beziehzeit von Vorteil. Auch den noch Monate später entstehenden gefährlichen Feuchtstellen muss vorgebeugt werden. Klimatechniker.net informiert Sie über die Details der Bautrocknung.
Sie beziehen einen Neubau und schon einige Wochen nach dem Einzug entdecken Sie Feuchtstellen an den Wänden, das Parkett quillt auf und ein muffiger Geruch zieht durch den Wohnraum. Der Boden, gar sämtliche Wände sind zu feucht und können die abgegebene Luftfeuchtigkeit der Bewohner nicht mehr aufnehmen. Der Wasserdampf kondensiert an den Fenstern und Außenwänden Ihres vermeintlichen Traumhauses – ein Teufelskreis entsteht und die nachträgliche Gebäudetrocknung steht an. Anstehende (Gutachter-)Kosten, Gerichtsprozesse, Mietminderungen und vor allem eine erhebliche Minderung der Lebensqualität können mit einer fachgerechten Bautrocknung noch vor Beziehen der Wohnung vermieden werden.
Ursachen für Baufeuchte: Dies macht eine Bautrocknung unabdinglich
Baufeuchte ist nicht ausschließlich auf Fehler bei den Gewerken zurückzuführen. Ein Großteil des in den Unterkonstruktionen des Hauses eingelagerten Wassers ist auf die natürlichen Eigenschaften der Baumaterialien zurückzuführen und lässt sich dementsprechend auch nicht vermeiden – eine Trocknung des Baus ist unabdinglich. Backstein beispielsweise kann etwa 60 % seines eigenen Volumens an Wasser aufnehmen; Ziegelmauerwerk benötigt mitunter etwa ein Jahr-, handelsüblicher Beton braucht bis zu 800 Tage, um zu trocknen.
Dies sind natürliche Ursachen für Baufeuchte:
- Der natürliche Wassergehalt der Bausubstanzen
- Bindewasser für die Herstellung von Beton, Mörtel, Fliesenkleber, Malerfarben, Tapetenkleister usw.
- Wasser für Mauersteine, Beton und Putz
- Lagerungsfeuchte
- Regenfeuchte durch nicht vorhandenen Wetterschutz
- Klimabedingtes Kondenswasser
In den Kapillaren, Poren, Spalten und Fugen eines Mauerwerkes befinden sich nach Abschluss des Baus beträchtliche Mengen an überschüssigem Wasser. Je nach Art des Baustoffes kann der Wassergehalt bis zu 200 Liter pro Kubikmeter betragen. Bei einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern wird mit etwa 1.500 Liter Wasser gerechnet, welches nicht für die Kristallisierung der Bausubstanzen benötigt wird. Selbst ein einwandfreier Bauprozess führt also letztlich zu Feuchtigkeit in den Wänden.
Unnatürliche Gründe für Baufeuchte schlagen auf die schon bestehenden klimatischen Bedingungen für Wassereinlagerung und machen eine fachkundige Bautrocknung umso wichtiger:
- Rohrbrüche
- Montagefehler im Rohrleitungsnetz
- Rückstau in der Abwasserleitung durch verstopfenden Bauschutt
- Unverschlossene Bohrungen für Versorgungsleitungen
- Fehlerhafte Abdichtungen
Die Feuchtigkeit lagert sich hier nicht nur durch die direkte Exposition oder das hineindiffundieren von Wasser in den Wänden. Auch das Grundwasser kann durch mangelhaft angelegten Beton dringen und durch die sogenannte Kapillarwirkung vom Fundament bis hoch in die Wände des Baus aufsteigen.
Wann wird der Bau getrocknet
Die Bautrocknung kann noch während der Arbeiten am Rohbau vollzogen werden. Das sollte sie sogar, um sich sämtlicher Feuchtestellen zu entledigen und einen trockenen Bauuntergrund noch vor weiteren Arbeiten und eventuellen Feuchteschäden garantieren zu können. So sollte dem frisch aufgetragenen Estrich nach fünf bis sieben Tagen das Wasser durch eine Bautrocknung entzogen werden. Das Mauerwerk sollte nur dann vor dem Verputzen getrocknet werden, wenn die Gefahr besteht, dass der Putz durch eine übermäßige Feuchte nicht an der Wand haften bleibt. Andernfalls sollte immer erst nach dem Verputzen und auch dem Verschütten des Estrichs getrocknet werden.
Treten nach dem Beziehen des Hauses sichtbare Wasserschäden auf, so wird eine nachträgliche Wasserschadenssanierung notwendig. Mangelhaft abgedichtete Dächer etwa können schnell für ärgerlichen Wassereinbruch sorgen und sogar die falsche Bautrocknung kann einem verzögerten Heraustreten des immer noch eingelagerten Wassers führen. Des Weiteren sind kalte Kellerbereiche besonders anfällig für die Anlagerung von Kondenswasser, weshalb unbedingt auf die richtige Lüftung geachtet werden und im Ernstfall auch hier ein Bautrockner für die richtige Luftfeuchtigkeit sorgen sollte.
Die Verfahren der Bautrocknung
Zunächst einmal sollte die Bautrocknung in einem lufttechnisch geschlossenen System stattfinden. Alle Öffnungen am Bauwerk sollten also mit Glas, Baufolie oder Dämmwolle geschlossen worden sein. Je höher die Differenz der Luftfeuchtigkeit zwischen Innen- und Außenbereich ist, desto effektiver ist die Trocknung.
Die Temperatur sollte hierbei mindestens zwei und allerhöchstens 35° Celsius betragen, andernfalls gestaltet sich die Bautrocknung für einige Gerätschaften als unökonomisch. Je nach klimatischen Bedingungen und Art der verwendeten Bausubstanz können unterschiedliche Geräte für die Trocknung gemietet und verwendet werden:
- Der Kondensationstrockner ist die am weitesten verbreitete Trocknungsmethode. Hier wird die Luft abgekühlt und zum Kondensieren gebracht. Das Kondenswasser wird in einem separaten Behälter aufgefangen und die Luft wird erhitzt wieder ausgespeist. Hierbei wird der Raumluftfeuchtigkeit schonend und gleichmäßig auf 40 bis 50 % gesenkt und Rissbildungen und Abplatzungen am Putz sind gänzlich vermeidbar.
- Adsorptionstrockner entziehen der Luft mittels Trockenmitteln die Feuchtigkeit. Diese Methode kommt hauptsächlich bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen zum Einsatz und kann eine Ziel-Luftfeuchte von bis zu fünf % erreichen. Es ist jedoch für eine entsprechende Zuluft ist zu sorgen, da die feuchte Regenerationsluft über eine Gebäudeöffnung an die Außenluft abgegeben werden muss.
- Bei Mikrowellentrocknern sollte etwa zunächst 20 Tage mit der Bautrocknung gewartet werden, da hier der Baustoff innerhalb weniger Minuten auf sehr hohe Temperaturen erhitzt wird. Sind zum Zeitpunkt der Trocknung noch nicht alle Abbindeprozesse der Bausubstanzen vollzogen, kann der hohe Dampfdruck in den Kapillaren, welcher die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk presst, zu Rissen und Abplatzungen führen.
- Von Bauheizern sollte grundsätzlich abgesehen werden, da die Hitze zu Verkrustungen an den Oberflächen führt. Lediglich an der Oberfläche entweicht die Baufeuchte – tieferliegende Wassereinlagerungen werden buchstäblich eingeschlossen und können später zu einer erneuten Durchfeuchtung führen. Des Weiteren ist auf das Heizen mit Gas und Öl zu verzichten, da bei der Verbrennung dieser erhebliche Mengen an Wasser ausgeschieden werden.