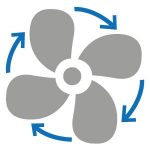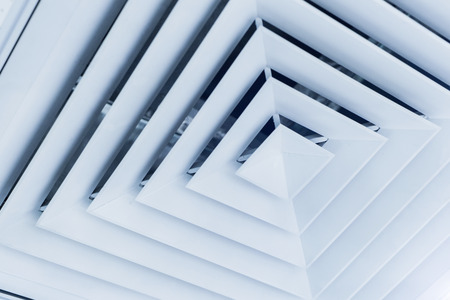Die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen beeinflusst nicht nur das menschliche Wohlbefinden, sondern auch maßgeblich die Gesundheit. Damit die Luft im Haus weder zu feucht noch zu trocken ist, sollten Sie ein System zur Feuchterückgewinnung einbauen lassen. Alle Informationen dazu gibt es im nachfolgenden Artikel.
Im modernen Wohnhaus werden Fenster nicht länger geöffnet. Die Immobilie wird mithilfe einer speziellen Anlage regelmäßig gelüftet. Das Problem: Im Winter sinkt dadurch die relative Luftfeuchte im Raum auf sehr niedrige Werte. Mit der Feuchterückgewinnung können Sie dieses Problem jedoch erfolgreich beheben.
Feuchteschutz gemäß DIN 1946–6
Gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Lüftungssysteme für Wohngebäude Pflicht. Als Orientierung gilt die DIN-Norm 1946–6: Darin werden Mindestluftwechselraten gefordert, die eine Schimmelbildung durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verhindern sollen; außerdem soll die Energieeffizienz gesteigert werden.
Im Winter entsteht jedoch ein Problem: Klassische Lüftungsanlagen sorgen für trockene Luft. Die alltäglichen Feuchtigkeitseinträge von Pflanzen, Duschen oder Kochen reichen nicht aus, um entgegenzusteuern. Aus diesem Grund sollte jede Wohnungslüftungsanlage eine Feuchterückgewinnung besitzen.
Geräte mit Feuchterückgewinnung und Wärmerückgewinnung
Die Wohnungslüftung resümiert sich in den meisten älteren Immobilien nach wie vor auf das altbewährte Prinzip: Fenster in regelmäßigen Abständen öffnen. Aus Zeitmangel wird gerne Mal auf das Stoßlüften zu geeigneten Tageszeiten verzichtet, sodass den Wohnräumen der nötige Luftaustausch fehlt. Das Resultat: Die Luft wird als muffig empfunden und sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu feucht.
Moderne Wohnungslüftungsanlagen mit Funktionen zur Feuchterückgewinnung sind in der Lage, diesen Prozess zu automatisieren und sogar zu verbessern. Die Anlagen gewinnen nämlich Abluftfeuchte, die sie dem Raum zurückführen. Drei Techniken kommen derzeit zum Einsatz:
- Entalphieverfahren
- Sorptionsverfahren
- Kondensationsverfahren
Beim ersten Verfahren, das beim Membranwärmetauscher zum Einsatz kommt, grenzen viele schmale Membranen Abluft- und Zuluftkanäle ab, sodass Feuchtigkeit gebremst wird, sobald frische Luft hindurchströmt. Die Membranplatte besitzt zudem eine Speichermasse, die Abluftwärme an die Zuluft überträgt.
Eine Alternative zum zuvor genannten Plattenwärmetauscher ist der sogenannte Rotationswärmeübertrager, auch Regenerator-Wärmetauscher genannt. Feuchte und Wärme werden von einem aus Aluminiumlamellen bestehenden Rotor gemäß des Kondensationsprinzips übertragen. Dieses ist für Einfamilienhäuser in Nord- und Mitteleuropa bestens geeignet. Gerüche werden nicht übertragen, da es eine Spülzone gibt, die die in der einströmenden Luft enthaltene Kondensation eliminiert. Mehr zum Thema Wärmerückgewinnung lesen Sie auch in diesem Artikel.
Wohnlüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung: Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme
Enthalpie-Plattenwärmeübertrager haben den Vorteil, dass sie fast keine beweglichen Verschleißteile benötigen; lediglich eine Bypassklappe ist für den Betrieb im Sommer nötig. Aber: Die Membran unterliegt einem Verschleiß, der die Rückgewinnungsrate negativ beeinflussen kann. Dafür punkten Plattenwärmetauscher mit geringeren Stromkosten, da keine Energie nötig ist, um sie anzutreiben. Eine Ausnahme gilt in bestimmten Wohngebieten, wo der Tauscher einfrieren kann. Damit dies nicht geschieht, muss ein Heizregister vorgeschaltet werden, dessen Strombedarf mit dem Leistungsbedarf eines Rotorantriebs vergleichbar ist.
Eine Vereisungsgefahr gibt es bei Rotationswärmeübertragern praktisch nicht. Daten eines Pilotprojekts (KfW–40-Haus) zeigen, dass die Luftfeuchte nicht unter 30 Prozent absinkt, wenn die Wärme- und Feuchterückgewinnung mit einem Kondensationsrotor und einer Luft- oder Luft-Wasser-Wärmepumpe erfolgt.
Energieeinsparung bei der Klimatechnik
Neben dem erhöhten Wohnkomfort in Ihrem Haus profitieren Sie beim Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärme- und Feuchterückgewinnung von einem reduzierten Energieverbrauch. Die Kühlung mit Außenluft ist in einigen Monaten des Jahres möglich, ohne dass ein Klimagerät eingeschaltet werden muss. Im Sommer wiederum sinkt der Energieverbrauch der Klimaanlage durch den Einsatz des Lüftungssystems.
Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung: Planung und Einbau nur vom Profi
Ob im Alt- oder Neubau – die Planung und den Einbau einer Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung sollten Sie einem Klimatechniker überlassen. Er wird eine Bestandsanalyse durchführen und feststellen, welches System für Ihr Gebäude geeignet ist. Dabei muss er in erster Linie Ihr Budget, die Wohnfläche, den Luftdurchsatz in Kubikmeter pro Stunde sowie den Wirkungsgrad berücksichtigen.
Überlassen Sie auch den Einbau der Anlage einem Profi, damit das Gerät ganzjährig korrekt funktioniert und die Raumluftfeuchte in einem akzeptablen Bereich bleibt.
Von der gleichbleibenden Feuchte profitieren übrigens nicht nur die Einwohner, sondern auch Ihr Haus und Ihre Einrichtung. Insbesondere Holzmöbel und Holzböden unter optimalen Bedingungen erleiden keine Trockenheitsschäden mehr.
Gesundes Raumklima: Der ideale Luftfeuchtewert in Wohnräumen
Die optimale Luftfeuchtigkeit hängt von dem jeweiligen Raum und der Temperatur ab. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über ideale Richtwerte, die in Ihrem Heim erreicht werden sollten:
- Wohn- & Arbeitsräume: 20°C Raumtemperatur + 40–60% Luftfeuchtigkeit
- Kinderzimmer: 20–22°C Raumtemperatur + 40–60% Luftfeuchtigkeit
- Schlafzimmer: 16–18°C Raumtemperatur + 40–60% Luftfeuchtigkeit
- Küche: 18°CRaumtemperatur + 50–60% Luftfeuchtigkeit
- Badezimmer: 23°CRaumtemperatur + 50–70% Luftfeuchtigkeit
In der Küche und im Badezimmer herrscht meist eine überdurchschnittlich hohe Luftfeuchtigkeit. Da Sie sich hier aber nur für kurze Zeit aufhalten, beeinflusst diese Ihre Gesundheit jedoch nicht negativ. Anders sieht es in den Wohn- und Schlafräumen aus. Hier sollten Sie darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit auf keinen Fall über 60 Prozent liegt – insbesondere vor dem Einschlafen. Wer nämlich mit geschlossenem Fenster schläft, der produziert beim Ausatmen stundenlang Feuchtigkeit und trägt zwangsläufig zur Erhöhung des Wertes bei.
Zu trockene Luft und ihre Auswirkungen
Neben einer zu feuchten Raumluft kann es auch vorkommen, dass sie gar zu trocken ist. Eine Literaturstudie, die von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) in Auftrag gegeben wurde, verdeutlicht die Auswirkungen von trockener Raumluft auf Menschen. Das größte Problem ist dabei der hohe Staubgehalt in der Luft, der insbesondere allergischen Menschen Probleme bereitet. Doch auch Mikroorganismen leben in trockener Luft länger.
Experten raten übrigens nicht zur Installation von Raumluftbefeuchtern, da sie in puncto Hygiene Risiken mit sich bringen. Stattdessen sollten Sie sich für eine systemintegrierte Feuchterückgewinnung entscheiden, um auch dieses Problem zu vermeiden.