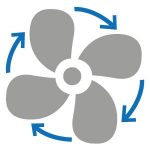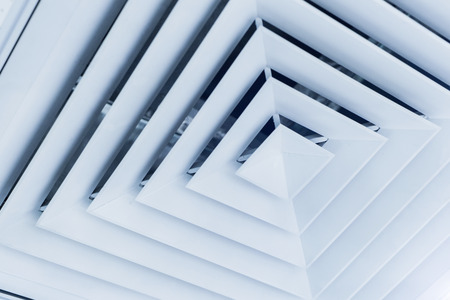Warum ist richtiges Lüften wichtig?
Lüften bedeutet nicht nur, die Zimmerluft durch Frische von draußen zu ersetzen. Richtiges Lüften beeinflusst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen – beides verantwortlich für die Qualität der Luft. Durch Luftzufuhr ändert sich aber auch der Sauerstoffgehalt und die Staubbelastung. Wer richtig lüftet, schafft also ein gesundes Raumklima und sorgt der gefährlichen Schimmelbildung vor.

Richtiges Lüften ist gleich aus mehreren Gründen wichtig: aus ästhetischen, gesundheitlichen, aber auch formellen. Stickige Luft ist unangenehm für die Nase, ganz besonders dann, wenn man den Raum von Außen betritt. Wer zu selten oder falsch lüftet, riskiert aber vor allem ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen: von Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen über Schwindel und Schwächung der Abwehrkräfte bis hin zu chronischen Erkrankungen, wie Allergien, Herzrhythmusstörungen oder Atemwegsbeschwerden.
Physikalisch gesehen heißt richtig lüften hauptsächlich, für die optimale Luftfeuchtigkeit zu sorgen, um die Bildung von Schimmel zu vermeiden. Nach längerer Zeit bei geschlossenen Fenstern reichert sich die Zimmerluft nämlich mit der ausgeatmeten Luft an, da der Atem wärmer und feuchter ist als frische Luft von draußen. Führen Sie die Luftfeuchtigkeit nicht richtig ab, wird das Wachstum von Hausstaubmilben und Schimmelpilzsporen begünstigt. Beides kann Allergien hervorrufen. Unzureichendes Lüften kann darüber hinaus auch rechtliche Folgen haben, wenn Sie zur Miete wohnen: Richtig lüften und heizen ist Mieterpflicht. Entstehen unschöne Flecken an der Wand oder Decke, darf der Vermieter sie auf Ihre Kosten entfernen lassen.
Lüften im Alt- und Neubau
Das Thema Lüftung spielt sowohl im modernen Niedrig-Energie-Haus, als auch im herkömmlichen Altbau eine wichtige Rolle. Es kommt auf die richtige Methode an. Im Neubau – oder aufwändig saniertem Altbau – sorgen effiziente Wärmeschutzmaßnahmen dafür, dass die Wände „dichter“ sind als früher. Durch gut gedämmte Fenster, Türen und Fassaden entweicht feuchte Luft so gut wie gar von alleine nach draußen: Ein natürlicher Luftwechsel findet also nicht statt. Um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und so dem Wachstum von Schimmelpilzen entgegenzuwirken, wird in Neubauten in der Regel kontrollierte Wohnungslüftung eingebaut: mechanische Anlagen zur definierten Be- und Entlüftung. In Neubauten – aber auch beim Altbau nach einer Sanierung – kann für eine gewisse Zeit Baufeuchte auftreten. In massiv errichteten Gebäuden fällt dabei mehr Baufeuchte an als bei Leichtbauhäusern.
Bei Bestands- und Altbauten, in denen die Fenster erneuert wurden, die ausgefeilte Belüftungstechnik aber fehlt, müssen die Bewohner selbst Hand anlegen. Das heißt: die Fenster regelmäßig aufreißen und manuell lüften.
- Pro Minute beträgt das Atemvolumen bei Menschen durchschnittlich 8 Liter. Über 12.000 Liter Luft werden pro Tag ein und ausgeatmet.
- In bewohnten Räumen entsteht Feuchtigkeit: Bei einem 4-Personen-Haushalt kommen rund zwölf Liter Wasser pro Tag zusammen, die wieder nach außen gelangen müssen.
- Raumluftfeuchtigkeit kondensiert immer an der kühlsten Stelle eines Raumes.
Wie lüftet man richtig?
Richtig lüften heißt vor allem regelmäßig lüften, und das auch im eisigen Winter, wenn der Ansporn, kalte Luft von draußen in den wohlig warmen Raum zu lassen, eher gering ist. Entscheidet man sich für manuelle Lüftung, ist eine gute Lüftungsstrategie das A und O, um Schimmelbildung effektiv zu vermeiden und möglichst schnell ein angenehmes Raumklima zu erreichen.
Falsches Lüftungsverhalten
Der wohl häufigste Fehler beim Lüften – außer die Fenster ganz zuzulassen – ist die Kippstellung.
- Dauerkipplüften
Wenn die Fenster längere Zeit – also mehr als 60 Minuten am Tag – nur einen Spaltbreit geöffnet bleiben, kühlen die angrenzenden Bauteile – besonders am Sturz über dem gekippten Fenster – bei niedrigen Außentemperaturen stark aus und bieten der Feuchtigkeit in der Raumluft die Möglichkeit, sich an eben diesen Stellen niederzuschlagen. So kann der Schimmel wachsen. Ganz sicher aber die Heizkosten. - Zu kurzes Kipplüften
Wird das Fenster zum Lüften nur kurz und selten in Kippstellung gebracht, ist der Luftaustausch sehr gering. Durch den Spalt wird nur sehr wenig feuchte Luft ausgetauscht, die meiste Feuchtigkeit bleibt also im Raum und bietet Schimmel die besten Voraussetzungen für Wachstum. - Zu kurzes Stoßlüften
Bleibt das Fenster nur etwa eine Minute lang breit geöffnet, kann die Feuchtigkeit nicht in ausreichendem Maße nach außen gelangen. Die Konsequenz: Zu viel Luftfeuchtigkeit im Raum. - Zu langes Stoßlüften
Reißen Sie die Fenster über 20 Minuten lang auf, geben Sie Schimmel zwar keine Chance, brauchen aber deutlich mehr Energie, um den Raum wieder auf erträgliche Temperaturen zu bringen. Übers Ziel hinausschießen soll man also auch nicht.
Richtiges Lüftungsverhalten
Die beste Lüftungsstrategie heißt Stoßlüften – aber richtig, also lange und oft genug. Außer der Jahreszeit, an der man die Fensterlüftung anpassen muss, gibt es einige wenige Regeln zu befolgen.
- Ungehinderte Luftzirkulation
Die Fenster müssen richtig weit geöffnet und die Vorhänge zur Seite geschoben werden. Wenn Sie zusätzlich auch Innentüren öffnen, kann die Luft ungehindert zirkulieren. Je weniger Hindernisse die Luft zu überwinden muss, desto effektiver der Luftaustausch und desto eher können Sie die Fenster wieder zumachen. - Richtig lüften – wie häufig?
Sind Sie tagsüber zu Hause, sollten Sie täglich mindestens viermal lüften. Bei Abwesenheit reicht ein Durchzug zwei bis dreimal am Tag, am Wochenende dann wieder häufiger. Eine Altbauwohnung mit hohen Decken, die sich sich nur schwer aufheizen lässt, soll nur zweimal täglich für ein kurzes Stoßlüften gelüftet werden. - Heizkosten sparen
Die Heizung soll während des Lüftens gedrosselt werden. Der schnelle Luftwechsel beim Stoßlüften kühlt die Raumluft nicht übermäßig ab, sodass Sie nach dem Vorgang schnell wieder angenehme Temperaturen erreichen.
Wie lüftet man im Sommer richtig?
Da die Außentemperaturen im Sommer in der Regel sehr hoch sind, sollen Sie am besten am frühen Morgen und spät abends lüften, wenn die Luft außen kühler ist. Kellerräume im Frühjahr und Sommer am besten nur nachts lüften, sonst schlägt sich die Luftfeuchte an den Kellerwänden nieder, die kälter sind als die Außentemperatur. Die empfohlene Lüftungsdauer im April und September beträgt 15 Minuten, im Mai und Oktober 20 Minuten und im Juni, Juli und August ungefähr 25-30 Minuten.
Wie lüftet man im Winter richtig?
Richtig lüften im Winter bleibt unter anderem so schwierig, weil man sich überwinden muss, die kuschelig warme Zimmertemperatur gegen kalte Frischluft von außen zu tauschen. Da die Räume bei der Lüftung schnell viel Wärme an die Umgebung abgeben, soll man im Winter nur kurz, aber weit und mehrmals am Tag aufreißen. Die Kellerräume soll man im Winter möglichst genauso lüften wie die Wohnräume. Im Dezember bis Februar ist die Dauer von ungefähr fünf Minuten optimal, im März und November zehn Minuten.
Wann lohnt sich eine automatische Lüftungsanlage?
Moderne Bauweise – aber auch die Sanierung der Altbauten – geht mit immer besserer Dämmung einher: Unsere Häuser werden immer luftdichter. Das hat zur Folge, dass ein unkontrollierter Luftaustausch durch Fugen und Ritzen nicht mehr möglich ist. Um eine Überfeuchtung der Räume zu vermieden und erfolgreich der Schimmelbildung vorzubeugen, macht es Sinn, eine automatische Lüftungsanlage in Erwägung zu ziehen. Diese lohnt sich insbesondere:
- bei fensterlosen Badezimmern und Küchen
- in gut gedämmten Neubauten und energetisch sanierten Altbauten
- wenn Sie keine Zeit haben, ausreichend zu lüften
Wenn die in Küche und Bad entstehende Feuchte nicht abtransportiert werden kann, ist das Risiko der Schimmelbildung sehr hoch. Die Luftfeuchtigkeit kann man dort zwar durch Aufdrehen der Heizung senken, auf Dauer treibt diese Strategie aber die Heizkosten unnötig in die Höhe. Auch wenn Sie berufstätig sind und keine Möglichkeit haben, Ihre Räume in der nötigen Häufigkeit zu lüften, sind Lüftungsanlagen eine sinnvolle Alternative zur klassischen Fensterlüftung. Eine mechanische, kontrollierte Wohnungslüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftwechsel im Gebäude.
Wann ist die manuelle Fensterlüftung nicht mehr ausreichend?
Ein einwandfreier Luftwechsel in Wohnräumen erfordert regelmäßige Lüftung, optimalerweise drei bis vier Mal am Tag. Im normalen Alltagsablauf ist das aber gar nicht zu leisten: Für gewöhnlich wird zu selten gelüftet oder nur mit gekippten Fenstern, was gerade im Winter in der Regel zu hohem Energieverlust führt. Auch bei häufigen Feuchtespitzen – etwa im Bad oder in der Küche – ist intensives Lüften nötig, das besonders in fensterlosen Räumen richtig problematisch wird. Manuelle Fensterlüftung erfordert Aufmerksamkeit und Konsequenz – ein Manko im Vergleich mit einer automatischen Wohnungslüftung.
Welche Vorteile hat die kontrollierte Wohnraumlüftung?
Automatische Wohnraumlüftung gewinnt seit einigen Jahren an Bedeutung und das nicht ohne Grund. Lüftungsanlagen sind keinesfalls ein kurzlebiger Hype, der bald wieder durch einen anderen heißen Trend ersetzt wird. Kontrollierte Be- und Entlüftung sorgt für konstant angenehmes Raumklima und passive Schimmelvorbeugung. Eine solche Anlage verhindert auch, dass eine zu hohe CO2-Konzentration entsteht.
Zusammengefasst punktet die kontrollierte Wohnraumlüftung mit folgenden Vorteilen:
- Schimmelpilzvermeidung: Regelmäßiger Luftaustausch sorgt für den Abtransport der im Gebäude entstehenden Feuchte.
- Optimales Raumklima: Neben der Regulierung der Luftfeuchtigkeit werden auch üble Gerüche abtransportiert.
- Flexibilität: Auch mit einer Lüftungsanlage können die Fenster jederzeit geöffnet werden.
- Schutz: Verbesserter Lärm-, Insekten- und Einbruchschutz.
- Komfort: Keine Kaltluftströmungen oder Durchzug: Der Luftaustausch erfolgt in geringerer Menge als bei der Fensterlüftung. Die Luft „bewegt“ sich also nur mit einer geringen Geschwindigkeit durch die Wohnräume.
- Luftqualität: Das Filtersystem in der Lüftungsanlage reinigt die Außenluft von Schmutz und Staub. Auch die Pollen werden so zurückgehalten und die Schadstoffe, die durch Ausdünstungen von Bodenbelägen, Möbeln und Reinigungsmitteln entstehen, werden durch den kontinuierlichen Luftaustausch erheblich minimiert.
- Regulierung: Eine kontrollierte Wohnungslüftung kann flexibel den augenblicklichen Anforderungen angepasst werden (Normallüftung, Nachtlüftung oder Partylüftung).
- Zusatzfunktionen: Lüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung gewinnen neben der Wärme auch einen Teil der Luftfeuchte aus der Abluft zurück. So trocknet die Raumluft besonders im Winter weniger aus.
Sucht man bei der kontrollierten Wohnraumlüftung nach Nachteilen, so muss die regelmäßige Kontrolle und beim Bedarf auch die Reinigung bzw. der Austausch der Filter genannt werden. Generell sind die Lüftungsgeräte aber bedienerfreundliche und wartungsarm. Je nach Modell und Belastung muss der Filter zwei- bis viermal im Jahr gereinigt oder ausgetauscht werden. Nach einer Einweisung können Sie das auch selbst übernehmen. Eine Inspektion durch Fachmann sollte alle zwei Jahre erfolgen. Die Kosten für einen Dienstleister sind nach Angaben des Verbandes Privater Bauherren als haushaltsnahe Dienstleistung oder als Handwerkerleistung von der Steuer absetzbar
Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau einer Lüftungsanlage erfüllt sein?
Beim Einbau einer Lüftungsanlage sind einige Dinge zu beachten – eine richtige Planung ist hier das A und O. Um böse Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt es sich die Hilfe eines Experten in Anspruch zu nehmen, bei den automatischen Lüftungsanlagen kommt es nämlich nicht nur auf die Art des Lüftungsgerätes an. Auch die Aufstellung, der Elektroanschluss, die Beschaffung der Rohre und die Luftschalldämpfung sind extrem wichtig.
- Der Standort
Bei der Aufstellung von Abluft-, Belüftungs- und Entlüftungsgeräten sollte der gewählte Standort möglichst kurze Wege zum Luftverteilsystem haben. Die Stelle selbst sollte eben, tragfähig und frostfrei sein sowie gut zugänglich für Filterwechsel und Wartung. Bei der Wärmerückgewinnung im Wärmetauscher muss das anfallende Kondensat frostfrei an eine Abwasserleitung angeschlossen werden. In einem Einfamilienhaus könnte ein Zentralgerät im Erd- oder Obergeschoss, etwa in Diele, Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum eingebaut werden. Auch Dachboden oder Kellerräume eigenen sich für die Aufstellung der Lüftungsanlage. - Maßnahmen gegen Körperschall
Wenn Sie auf zusätzliche Schalldämmmaßnahmen verzichten möchten, sollten Sie die Lüftungsgeräte auf Beton- oder Estrichboden aufstellen. Eine zusätzliche Entkopplung der Anlage durch eine Betonplatte mit Schwingungsdämpfern ist dann empfehlenswert, wenn Sie die Anlage auf Holzbalkendecken platzieren. - Elektrischer Anschluss
Für die Wohnungslüftungsanlage benötigen Sie einen separaten elektrischen Anschluss mit 230V und eine Absicherung 16 A. Das Gerät sollte einen Ausschalter besitzen. Einige Modelle sind schon mit Fernbedienungen ausgestattet. Müssen auch Verbindungsleitungen vom Lüftungsgerät zur externen Steuerung angebracht werden, empfiehlt sich die Beratung durch einen Experten. - Rohrleitungen und Zubehör
Zu- und Abluftleitungen werden in der Regel in Decken und Installationsschächten verlegt, manchmal müssen aber spezielle Kanäle auf Putz verlegt werden. Auch die Beschaffenheit der Rohre spielt eine Rolle. Glatte, runde Rohre verhindern die Ansammlung von Staubansammlungen und vermeiden unnötige Druckverluste. Eckige Kanäle sollten Sie vermeiden. Bei Umlenkungen sind große Radien vorteilhaft, damit der Druckabfall des Rohrleitungssystems möglichst gering gehalten wird. zu halten. Schlecht montierte Umlenkungen können störende Strömungsgeräusche erzeugen. - Luftschalldämmung
Unverzichtbar in der Zu- und Abluftleitung – unmittelbar nach dem Lüftungsgerät platziert – sind Schalldämpfer, um die Schallübertragung zwischen Räumen zu begrenzen. - Außenluftansaugung und Fortluftführung
Bei der Installation der Leitungen für die Zu- und Fortluft sollten Sie eine Vermischung der Luftströme unbedingt verhindern. Dafür muss die Ansaugöffnung für die Außenluft und die Ausblasöffnung für die Fortluft mit mindestens zwei Meter Abstand zueinander gelegt werden. Noch besser wäre eine Montage über Eck an zwei Gebäudeseiten. Bringen Sie die Ansaugstelle der Außenluft am besten dort an, wo möglichst geringe Verunreinigungen auftreten. zu rechnen ist. - Wärmedämmung und Schutz gegen Kondenswasser
Führen Lüftungsleitungen durch Kaltbereiche, müssen sie wärmegedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Als Dämmmaterial eignen sich Mineral- und Glaswolle oder Schaummaterialien. Zu- und Fortluftleitungen brauchen auch eine dampfdichte Ummantelung, damit die Wärmedämmung nicht durchfeuchtet wird.
Dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage: Was ist besser?
Lüftungsgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen, man unterscheidet insbesondere zwei Typen:
Zentrale Lüftungsanlagen sind besonders für sehr gut wärmegedämmte Neubauten geeignet. Über ein zentrales Aggregat, das meist im Keller aufgestellt ist, sorgt solche Anlage für den gleichzeitigen Luftaustausch im ganzen Haus. Das Aggregat mit einer Verbindung nach Außen belüftet die Räume über ein Rohrsystem, das allerdings ausreichend Platz benötigt. Bei mehrgeschossigen Häusern oder bei der nachträglichen Installation in Altbauten sind zentrale Lüftungsanlagen häufig problematisch.
Vorteile:
- Einfach zu installieren
- Geeignet für den Einbau in Altbauten
- Kostengünstiger als zentrale Lüftungsanlagen
- Geringe bauliche Maßnahmen notwendig
- Nachträglicher Einbau in Altbauten leicht zu realisieren
- Wärmerückgewinnung kann eingesetzt werden
- Bei der Belüftung weniger Räume kostengünstiger Betrieb
- Individuelle Luftsteuerung möglich
Nachteile:
- Hoher Kostenaufwand bei der Anschaffung im gesamten Gebäude
- Höhere Lärmbelastung bei mehreren Anlagen, Geräuschentwicklung in Schlafräumen kann störend sein
- Gefahr des Luftkurzschlusses
- Klimatisierung nur bedingt möglich
- Geringere Energieeinsparung als zentrale Anlagen
Dezentrale Lüftungsanlagen sorgen für den Luftaustausch in einzelnen Räumen. Jeder Raum hat ein eigenes Aggregat, meist in der Wand eingesetzt. Solche Geräte bewähren sich gut in Räumen mit hoher Feuchtigkeit, die sich gleichzeitig schlecht lüften lassen, wie etwa fensterlose Toilette, Küche oder Badezimmer. Auch in Räumen, in denen schlechte Gerüche entstehen, wie etwa in Raucherzimmern, werden dezentrale Lüftungsanlagen eingebaut.
Vorteile:
- Hohe Energieeinsparungen möglich
- Geräuschentwicklung durch zentrales Lüftungsgerät und Schallschutzklappen unproblematisch
- bei richtiger Planung keine Gefahr des Luftkurzschlusses
- Klimatisierung der Zuluft möglich
Nachteile:
- Anschaffung sehr kostenintensiv
- Meist ungeeignet für den Einbau in Altbauten
- Hoher baulicher Aufwand
- Höherer Wartungsaufwand für hygienischen Betrieb
Was besagt die DIN 1946-6 „Lüftung von Wohnungen“?
DIN 1946-6 „Lüftung von Wohnungen“ wurde nach mehrjähriger Überarbeitung im Mai 2009 veröffentlicht. Die Norm zeigt Lösungsmöglichkeiten, wie ein ausreichender Luftwechsel in Wohnungen erreicht werden kann und schafft damit Regeln für die Belüftung von Wohngebäuden. Sie legt auch Grenzwerte, aber auch Berechnungsmethoden für den notwendigen Luftaustausch fest. In erster Linie betrifft sie Neubauten, bei denen ein Lüftungskonzept nachgewiesen werden muss. Aber auch bei umfangreichen Sanierungen ist ein genormtes Lüftungskonzept vorgeschrieben. Das trifft Renovierungsmaßnahmen, bei denen über ein Drittel der vorhandenen Fenster gegen neue, also luftdichtere Varianten ausgetauscht oder mehr als ein Drittel der Dachfläche neu abgedichtet wird. Als Begründung führt die DIN 1946-6, dass Neubauten und modernisierte Wohngebäude so luftdicht seien, dass ohne den Einsatz technischer Lüftungssysteme die Fenster sehr häufig zu öffnen wären. Häufiges Fensterlüften ist zwar grundsätzlich möglich, wird aber ab einem gewissen Grad für die Bewohner als nicht zumutbar eingestuft.